
© iStock/thinkstock monsitj
US-amerikanische Start-ups haben innerhalb kürzester Zeit den Markt für Online-Auktionen, für Werbung und Kommunikation oder auch für die Vermietung von Ferienwohnungen vom Kopf auf die Füße gestellt. Stellt sich die Frage: Warum gibt es keine vergleichbaren Ideen aus Deutschland? Fehlt es Gründerinnen, Gründern und Unternehmen hierzulande an zündenden Ideen? Im Gegenteil! „In Deutschland gibt es jede Menge hervorragende Produkte“, sagt Dr. Thomas Heimer, Professor für Innovationsmanagement und Projektmanagement an der Hochschule Rhein-Main und wissenschaftlicher Leiter der Technopolis Group. „Wir haben hoch innovative Produkte, wie zum Beispiel im Bereich der Smart-Home-Technologien. Und dennoch stehen deutsche IT-Unternehmen vielfach vor dem Problem, dass sie sich nicht als Marktführer auf dem internationalen Markt behaupten.“
Wobei fairerweise ergänzt werden muss, dass es eine ganze Reihe technologieorientierter Start-ups gibt, die mit ihren innovativen Produkten durchaus erfolgreich weltweit Marktnischen besetzen. Dazu gehören auch ehemals EXIST-geförderte Start-ups. Sei es die Compositence GmbH, Hersteller von carbon- und glasfaserbasierten Bauteilen, die fos4X GmbH, Entwickler von Messtechnik für Windkraftanlagen oder die Coriolis Pharma Research GmbH, Dienstleister im Bereich Biotech-Pharma. Sie bilden nur einen kleinen Ausschnitt einer inzwischen beachtlichen Zahl von Gründerinnen und Gründern, die es geschafft haben, aus einem universitären Forschungsprojekt ein international erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Damit gehören sie zu den vielen Hidden-Champions, die typisch für den deutschen Mittelstand sind: hoch innovativ, in der Regel im B2B-Bereich unterwegs, spezialisiert auf eine Marktnische, im engen Austausch mit ihren Kunden und weltweit erfolgreich.
Doch so positiv die Erfolge junger deutscher Hidden Champions auch sind: Wo sind all die anderen Unternehmen, die keine Nische, sondern Konsumenten und Nutzer weltweit bedienen möchten? Die mit ihrer innovativen Technik und ihren Algorhitmen den internationalen B2C-Markt aufmischen möchten? Einfach gefragt: Warum gibt es in Deutschland bislang kein Unternehmen, das mit Google, Apple oder Facebook vergleichbar ist?
Blinder Fleck: Anwendungskontext und Kundenorientierung
Einen Grund dafür hat Professor Thomas Heimer in der von ihm erstellten Studie „Nichttechnische Innovationen – Welche Impulse setzt der Markt? Welche Rolle hat der Staat?“ identifiziert, die 2016 im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums herausgegeben wurde: „Die Perspektive vieler Unternehmen ist verzerrt. Die sind zu technikfokussiert. Davon müssen wir uns in Deutschland lösen und uns mehr der im nicht technischen Bereich angesiedelten Wertschöpfungsperspektive widmen.“
Dazu gehört vor allem die konsequente und fortlaufende Ausrichtung des Produkts am Kunden. „Wenn Sie sich Booking.com oder Facebook anschauen, werden da fast täglich im Zusammenspiel zwischen den Nutzern und den Betreibern der Plattformen neue Anwendungen entwickelt und getestet. Dagegen ist der traditionelle Entwicklungsprozess, den wir aus den Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften kennen, eher linear sequenziell angelegt. Das heißt, im Unternehmen entsteht eine Idee, die ein bestimmtes Problem für den Kunden lösen soll. Die FuE-Abteilung wird damit beauftragt eine Lösung zu erarbeiten und dann wird das neue Produkt auf dem Markt eingeführt. Bei der Mehrzahl der
technikdominierten Wertschöpfungsbeiträge kommt es dann immer zu einem sogenannten Freezing. Das heißt, das Feedback der Kunden wird im Unternehmen gesammelt, geht dann an die FuE-Abteilung, die an einer Verbesserung des Produkts arbeiten und nach einem oder mehreren Jahren, ist die nächste Produktgeneration auf dem Markt. Diese Sequenzialität, haben wir bei den erfolgreichen Unternehmen nicht. Gerade in der Digitalwirtschaft erfolgt die
Produktentwicklung interaktiv sozusagen in Echtzeit gemeinsam mit den Nutzern. Das ist der fundamentale Unterschied.“

© iStock/yacobchuk
Das Erfolgsgeheimnis von Facebook, Booking.com und Co. sind demnach weniger die viel zitierten und streng gehüteten Algorithmen, sondern vielmehr Geschäftsmodelle mit einer ausgeprägten Marketingkomponente, die alle Überlegungen zu Kunden, Produkt, Vertrieb und Kommunikation von Anfang an im Blick haben. Dabei bieten diese Überlegungen jenseits der technischen Entwicklungsarbeit viel Spielraum für Innovationen, vor allem dann, wenn es gelingt, die Wünsche und Bedürfnisse von potenziellen Kunden ein Stück weit zu antizipieren. Dr. Klaus Sailer, Professor für Entrepreneurship an der Hochschule München und Geschäftsführer des Strascheg Center for Entrepreneurship: „Niemand hat Marc Zuckerberg gesagt, dass wir so etwas wie Facebook brauchen. Weltweit Leute kennenzulernen und mit ihnen jederzeit kommunizieren zu können, sind viel mehr implizite Wünsche, die vor Facebook niemand konkret als Wunsch formuliert hat. Dennoch zu erkennen, dass es dieses Bedürfnis gibt, ist genau das, was Entrepreneurship ausmacht. Es reicht nicht aus, die Kunden zu fragen, was sie in Zukunft brauchen. In der Regel wissen sie es selber nicht. Die Aufgabe innovativer Entrepreneure ist es daher, Menschen genau zu beobachten, dabei ein Problem oder Bedarfe zu erkennen und sich dann Gedanken über mögliche Lösungen zu machen. Das sind letztlich die Entrepreneure, die die Welt verändern – wobei dahingestellt ist, ob es immer zum Guten ist.“
Tatsächlich aber ist es so, dass viele deutsche Start-ups immer noch zu spät auf potenzielle Kunden zugehen und ihr Produkt an den Kundenbedürfnissen vorbei entwickeln oder sich zu spät Gedanken darüber machen, wie sie ihr Produkt tatsächlich „an den Mann“ bzw. „die Frau“ bringen wollen. Notdürftig werden dann im Nachhinein noch eine Werbekampagne um das Produkt „herumgestrickt“ und dringend Investoren gesucht, um einen vernünftigen Vertrieb aufzubauen. Die Chance für einen Durchbruch auf dem Markt wird damit verspielt.
Nicht technisches Innovationspotenzial stärker wahrnehmen
Dabei sind nicht technische Innovationen weit mehr als nur „Geburtshelfer“ für technische Lösungen. Ihr Wirkungskreis ist weitaus größer und schließt organisatorische, soziale, kommunikative oder auch kulturelle Ideen mit ein.
Deren innovatives Potenzial werde allerdings immer noch unterschätzt, so Dr. Werner Rammert, Professor für Techniksoziologie an der Technischen Universität Berlin: „Ein typischer Fall selektiver Wahrnehmung. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass Ideen mit einem sehr geringen technischen oder materiellen Input einen großen Beitrag zum ökonomischen Erfolg von Unternehmen geleistet haben. Nehmen Sie allein die Konzepte von Sozial- und Arbeitswissenschaftlern im Bereich der Mitarbeiterführung, der Arbeitsorganisation oder der Unternehmenssteuerung, die zu effizienteren Arbeitsprozessen und Kosteneinsparungen geführt und einen großen Anteil daran haben, dass Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben.“ Die Crux ist allerdings, dass sozial- und arbeitswissenschaftliche Ideen in der Regel nicht als Innovation wahrgenommen und bei allen Entwicklungsbemühungen eher stiefmütterlich behandelt werden.
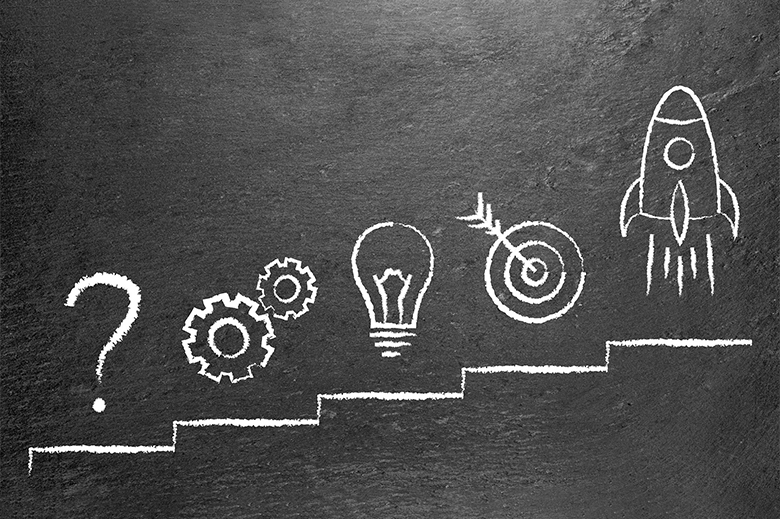
Start-up Entwicklung
© iStock - pixelliebe
Innovationen ganzheitlich betrachten
Dass technische und nicht technische Innovationen zwei Seiten ein und derselben Medaille und damit untrennbar miteinander verbunden sind, davon ist Prof. Werner Rammert überzeugt. Schließlich trage jede Innovation sowohl eine technische als auch eine nicht technische Komponente in sich, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung. „Auch bei vermeintlich nicht technischen Innovationen wie der effizienten Gestaltung von Arbeitsabläufen, benötigen Sie Messinstrumente, Software und eventuell auch neue Produktionsmaschinen. Und selbst wenn Sie ein pädagogisches Konzept wie einen Montessori-Kindergarten umsetzen, braucht es dazu spezielles Spielzeug und Mobiliar.“
Innovative Ideen anstatt technische Innovationen fördern
Dieser ganzheitliche Blick auf Innovationen ist jedoch immer noch die Ausnahme, nicht zuletzt in der Innovationsförderung. Grund dafür ist für Professor Thomas
Heimer der Umstand, dass dem Beitrag nicht technischer Ideen zur wirtschaftlichen Wertschöpfung nach wie vor zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Dabei stehen viele Förderinstitutionen und Förderprogramme nicht technischen Innovationen beispielsweise im Bereich Organisation oder Strategie formal offen gegenüber. Doch die Realität sieht meist anders aus.
Diese Trennung von technischen und nicht technischen Innovationen, diese „Schere im Kopf“ derjenigen, die über Förder- und Beteiligungsanträge entscheiden, hält Professor Klaus Sailer denn auch für überdenkenswürdig. „Hinter echten Innovationen steht doch immer ein umfassendes Businessmodell. Da wird nicht nach technischen und nichttechnischen Komponenten unterschieden. Ich würde daher
viel mehr dafür werben, innovative Ideen zu fördern, anstatt technische Innovationen.“ Darüber hinaus soll der Zugang zu Finanzierungsinstrumenten für Gründer aus den Sozialwissenschaften, der Germanistik, der Philosophie, der Kunst- und Kreativbereich verbessert werden. Denkbar wären zum Beispiel spezielle VC-Fonds für nicht technisch orientierte Start-ups, so Professor Klaus Sailer: „Der Anteil der Gründerinnen und Gründer mit Ideen aus dem überwiegend nicht technischen Bereich ist weitaus höher als der Anteil technologieorientierter Gründungen. Letztere haben aber bei Investoren die weitaus größeren Chancen. Das bedeutet,
der überwiegende Teil der Gründungsvorhaben erhält gar nicht die Möglichkeit, seine Geschäftsidee mit Hilfe einer entsprechenden Finanzierung zu skalieren, wenn Crowdfunding für das Projekt nicht in Betracht kommt. Ein Grund ist, dass diese Unternehmen in der Regel nicht so schnell wachsen. Man müsste also Fonds konstruieren, die sich nicht an einer schnellen Renditeerwartung orientieren, sondern auf andere Weise, zum Beispiel durch eine Umsatzbeteiligung,
am Wachstum der Unternehmen partizipieren. Aber bislang funktioniert der Venture-Capital-Markt bis auf Ausnahmen wie das Crowdfunding nach den gleichen Prinzipien und Auswahlkriterien wie vor 30 Jahren. Und das, obwohl das Innovationspotenzial im Bereich der nicht technischen Innovationen sehr vielversprechend ist, gerade auch was die Lösung zukünftiger gesellschaftlicher Probleme angeht.“
In dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob die in der aktuellen Diskussion verwendete Bezeichnung der „nicht technischen“ Innovation überhaupt angemessen ist. Neuartige Dienstleistungen, Vertriebs- und Organisations- oder Designkonzepte unter einem Begriff zusammenzufassen, der sich allein über deren Verhältnis zur Technik definiert und damit negativ konnotiert ist, trägt kaum dazu bei, Gleichwertigkeit herzustellen.

© iStock/Geber86
Die Bezeichnung „nicht technisch“ ist darüber hinaus ohnehin zu kurz gegriffen, berücksichtigt man auch Innovationen, die nicht unmittelbar zur ökonomischen Wertschöpfung beitragen. Auch in der Kultur, im Sozialen und in der Politik
entstehen Innovationen, ist Professor Werner Rammert, Initiator des interdisziplinären Kollegs „Innovationsgesellschaft heute“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft, überzeugt: „Die Bismarcksche Sozialgesetzgebung, der deutsche Kindergarten oder auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz zählen zweifellos zu den sozialen und politischen Innovationen. Oder nehmen Sie die betriebliche Mitbestimmung und die Einbindung der Gewerkschaften. Die haben in der Bundesrepublik zweifellos zum sozialen Frieden beigetragen und standen in den siebziger Jahren für das Modell Deutschland. Oder nehmen Sie aktuell die vielen verschiedenen Verkehrskonzepte, die ja nicht nur den Verkehr neu ausrichten, sondern unsere Städte insgesamt wieder lebenswerter machen möchten.“
Innovative gesellschaftliche Dynamik unterstützen
Eine zeitgemäße Innovationsförderung nicht mehr nur auf eine ökonomische Wertschöpfung und damit verbundene technischen Innovationen zu konzentrieren ist dabei erst der Anfang. Dazu kommt: Die aktuellen und zukünftigen globalen Herausforderungen sind zu groß, als dass sie von einer hoch motivierten, aber letztlich überschaubaren Social-Start-up-Szene gelöst werden könnten. Professor
Klaus Sailer: „Innovationen sind in Zukunft vor allem auch dafür wichtig, zu einem neuen Verständnis von Entrepreneurship kommen. Ich denke, der Begriff des Responsible Entrepreneurship trifft es am besten. Es geht darum, dass jeder Gründer und jeder Unternehmer Verantwortung übernimmt und einen positiven Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt erzielt. Dafür gibt es schon jetzt gute innovative Ideen. Viele können aber nur dann realisiert werden, wenn ihre innovativen sozialen Wirkkräfte genutzt und angemessen unterstützt werden.“
Die Langfassung des Artikels finden Sie in der Broschüre „Das ist EXIST 2017“ auf S. 23.



